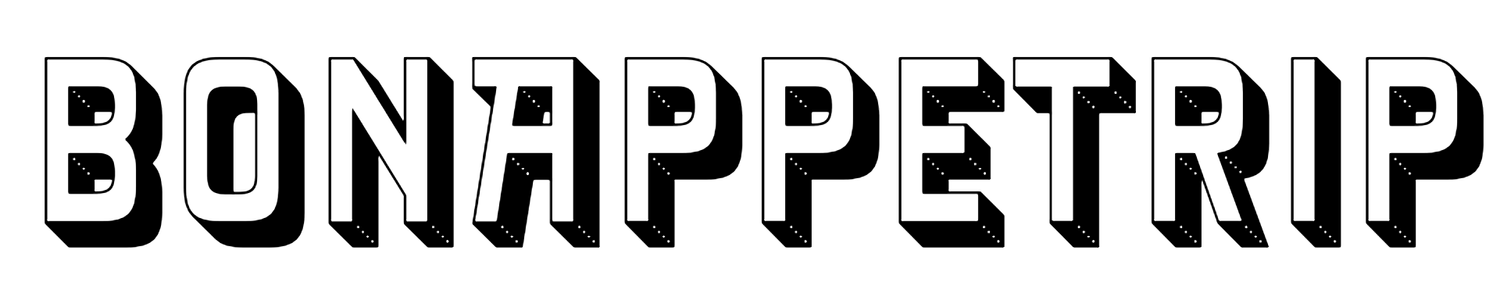Mehr als nur eine Mahlzeit
Wie Politik, Gender Issues, identitätsfragen und rassismus unser Essen beeinflussen
Disclaimer: Dieser Text ist eine Abschrift eines Workshop, den ich für die New York University gegeben habe. Da er recht lang geworden ist, habe ich eine Audio-Version aufgenommen.
Essen ist weit mehr als nur Nahrungsaufnahme. Jede Mahlzeit erzählt Geschichten über Herkunft, Macht, Zugehörigkeit und Wandel. Wer genauer hinsieht, erkennt, dass sich in einem Teller Spaghetti oder einem Stück Brot tatsächlich ganze gesellschaftliche Strukturen spiegeln können.
Ob es um Geschlechterrollen in der Küche geht, um Fragen von Identität, um politische Macht oder um Rassismus, Essen ist immer auch ein politischer, sozialer und kultureller Ausdruck.
Wer kocht und wer dafür Anerkennung bekommt
Weltweit leisten Frauen über 70 Prozent der unbezahlten Arbeit rund um Lebensmittel und Ernährung. Sie kochen, kaufen ein, versorgen Familien. Und das meist, ohne dass ihre Arbeit als solche anerkannt wird. Die Arbeit am Herd gilt vielerorts als selbstverständlich, als Ausdruck von Fürsorge, selten als Leistung.
In der privaten Küche ist Kochen häufig weiblich konnotiert, in der professionellen Küche dagegen männlich. Während Männer in Spitzenrestaurants als kreative, mutige Küchenchefs gefeiert werden, kämpfen Frauen mit Misstrauen, Belästigung und strukturellen Hürden.
In Gesprächen mit zwölf Köchinnen für unsere Podcast-Reihe „Schnitzel & Stories“ wurde deutlich, wie ähnlich ihre Erfahrungen sind: Symbolpolitik statt echter Wertschätzung, körperliche Übergriffe, gestohlene Ideen, Horror-Arbeitsklima. Viele Frauen verlassen diese Küchen, nicht weil ihnen die Leidenschaft fehlt, sondern weil das Umfeld feindlich bleibt und sie rausgeekelt werden. Forschende sprechen in diesem Zusammenhang von der „Leaky Pipeline“, dem schleichenden Verlust weiblicher Karrieren, weil Strukturen sie nicht halten. In der Gastronomie bedeutet das häufig: Rückzug in die Pâtisserie, den einzigen Bereich, in dem Frauen vergleichsweise ungestört arbeiten können. Oder die Frauen verschwinden gänzlich aus der Gastronomie.
Was Essen über unsere Herkunft erzählt
Essen ist einer der stärksten Marker für Identität. Jeder Bissen stellt Fragen nach Herkunft, Zugehörigkeit und Selbstverständnis. Gerichte sind Träger von Erinnerungen, an die Familie, die Heimat oder auch an Migration.
Zutaten und Rezepte entstehen im Spannungsfeld zwischen globalen Lieferketten und lokalen Bräuchen. Ihre Auswahl spiegelt Herkunft und Wandel zugleich. Was als „typisch“ oder „authentisch“ gilt, ist dabei selten objektiv, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Zuschreibungen.
Selbst alltägliche Situationen zeigen, wie eng Identität und Essen miteinander verknüpft sind. Wenn Kinder ihr mitgebrachtes Essen in der Schule verstecken, weil es nicht dem entspricht, was als „normal“ gilt, und sie sogar dafür von anderen beschmipft und gemobbt werden, wird sichtbar, wie eng kulturelle Grenzen gezogen werden. Selbst beim Mittagessen.
Wer bestimmt, was gegessen wird?
Aber Essen ist immer auch eine Frage von Macht. Vom Saatgut bis zur Supermarktkasse entscheidet Politik darüber, wer Zugang zu Lebensmitteln hat und wer an ihnen verdient.
Themen wie Zuckersteuer, Subventionen oder Lebensmittelverschwendung sind längst keine Randfragen mehr. Sie bestimmen, was auf den Tellern landet, und für wen welches Essen erschwinglich ist. Nachhaltige Produkte oder Bioware sind nach wie vor ein Privileg, das sich nicht jede:r leisten kann.
Politische Entscheidungen im Ernährungssektor betreffen vor allem marginalisierte Gruppen. Wenn Subventionen vor allem großen Agrarkonzernen zugutekommen, während kleine Betriebe aufgeben müssen, wird deutlich, wie eng wirtschaftliche Interessen mit sozialer Ungleichheit verflochten sind.
Wessen Küche gilt als „gut“?
Auch Rassismus spielt in der Wahrnehmung von Essen eine Rolle. Manche Küchen gelten als „trendy“, andere werden abgewertet oder als „minderwertig“ betrachtet. Köch*innen mit Migrationsgeschichte erleben immer wieder, dass ihre Gerichte als „Ethno-Food“ abgestempelt werden. Exotisch, aber nicht gleichwertig, und bitte auf keinen Fall teuer!
Zugleich werden Rezepte aus Minderheitenkulturen kommerzialisiert, angepasst und vermarktet, ohne dass die Ursprünge gewürdigt werden. Wer bestimmt also, was „gutes Essen“ ist? Und wer profitiert davon?
Was und wie gekocht wird, ist oft von unsichtbaren Hierarchien geprägt. Am Esstisch, in Restaurants und in der medialen Darstellung.
Der Blick hinter den Tellerrand
Essen spiegelt gesellschaftliche Realitäten: Wer kocht und warum? Wer entscheidet, was gekocht wird, und wessen Arbeit, Kultur und Identität werden gewürdigt oder übergangen?
Die Geschichten hinter unseren Mahlzeiten erzählen von Macht, Herkunft und Zugehörigkeit. Sie zeigen, dass Essen nie neutral ist, sondern ein Ausdruck dessen, wer gesehen wird und wer nicht. Wer genau hinschaut, erkennt auf dem Teller weit mehr als nur eine Mahlzeit: ein Stück Gesellschaft.
Foto: Pexels